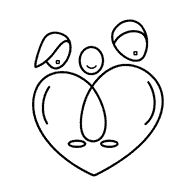„Und? Wie ist es mit zwei Kindern?“
Kaum eine Frage begleitet mich seit der Geburt unseres zweiten Kindes häufiger. Dabei klingt sie meist harmlos-neugierig – doch zwischen den Zeilen schwingt oft mit: Wie überlebst du das eigentlich?
Ich könnte mit einem Satz antworten: Mit viel Kaffee, einem großartigen Partner und realistischen Erwartungen.
Aber so einfach ist es natürlich nicht. Zwei unter drei – Liebe, Chaos, Kaffee
Der Altersabstand – eine bewusste Entscheidung
Bei vielen Paaren stellt sich relativ schnell die Frage: Wann ist der richtige Zeitpunkt für ein zweites Kind? So auch bei uns. Wir wussten früh: Wir wollen keinen großen Altersunterschied. Mir war wichtig, dass die beiden in ähnlichen Lebensphasen aufwachsen – sich irgendwann gemeinsam verbünden können, dass keiner dem anderen „meilenweit voraus“ ist.
Unser zweites Kind kam auf die Welt, als die große Schwester gerade einmal zwei Jahre alt war. Damit liegen wir fast im deutschen Durchschnitt: Laut Statistischem Bundesamt beträgt der mittlere Altersabstand zwischen Geschwistern hierzulande 2,5 bis 3 Jahre. Viele Eltern wünschen sich Kinder, die „nah beieinander“ sind – in der Hoffnung, dass sie gemeinsam aufwachsen, miteinander spielen, sich verbunden fühlen.
Auch für uns war dieser geringe Abstand kein Zufall, sondern Teil unserer Familienplanung. Wir wollten, dass unsere Kinder in ähnlichen Entwicklungsphasen groß werden – mit gemeinsamen Themen, ähnlichen Interessen, gegenseitigem Verständnis.
Zwei Kleinkinder = doppelte Liebe, doppelter Wahnsinn
Natürlich bringt diese Entscheidung Herausforderungen mit sich. Windeln für beide. Zwei, die nachts ins Elternbett wollen. Zwei, die sich nicht selbst anziehen können – aber gleichzeitig auf den Arm möchten. Zwei, die Mama brauchen. Jetzt. Sofort.
Und doch: Ich habe mich bewusst für dieses Familienmodell entschieden – mit all seinen Schattenseiten. Denn: Auch das zweite Kind soll das bekommen, was das erste hatte – Zeit, Nähe, Aufmerksamkeit. Und dafür braucht es einen Alltag, der das ermöglicht.
Ohne Team geht nichts – warum Gleichberechtigung der Schlüssel ist
Auch externe Unterstützung spielt eine große Rolle: Unsere Tochter besucht eine liebevolle Krippe und ist ein- bis zweimal pro Woche nachmittags bei den Großeltern. Diese Pausen schaffen Raum – für das Baby, für mich, für bewusste Zweisamkeit. Denn ich wollte nicht, dass unser Sohn das Gefühl hat, ein „Nachzügler“ zu sein. Auch er soll mit Mama Eltern-Kind-Kurse besuchen und erste kleine Freundschaften schließen.
Und am Nachmittag? Regiert die große Schwester
Natürlich läuft der Tag nicht linear. Am Nachmittag ist die große Schwester zurück – voller Energie, voller Geschichten. Dann muss sich der Kleine hinten anstellen. Und das ist okay. Denn Familienleben bedeutet nicht perfekte Gerechtigkeit, sondern ein ständiges Austarieren: Wer braucht gerade was – und von wem?
Die herausforderndste Stunde des Tages: Familienzeit
Unser Abend beginnt meist mit einem tiefen Seufzer. Die Batterien sind leer, die Stimmung kippt leicht. Und trotzdem ist das Abendessen unsere Zeit: Wir sind zusammen, erzählen, lachen, diskutieren. Ein kleines Ritual im Trubel.
Eltern sein – aber nicht nur Eltern
Trotz aller Anforderungen haben wir uns bewusst vorgenommen: Wir selbst dürfen nicht verloren gehen. Wir beide arbeiten, pflegen Hobbys, verfolgen Projekte. Ja, das ist viel. Aber wir empfinden es als bereichernd – weil wir erleben, dass Elternsein und Selbstverwirklichung sich nicht ausschließen. Manchmal ist es ein Drahtseilakt. Aber einer, den wir gern gehen.
Zwei unter drei – Liebe, Chaos, Kaffee
Die 30er und 40er gelten oft als Rush Hour des Lebens – Beruf, Familie, Partnerschaft, Selbstverwirklichung, Gesundheit, Freundschaften. Alles gleichzeitig. Mit zwei kleinen Kindern spürt man das besonders intensiv.
Aber genau das macht diese Lebensphase auch so reich:
Wir wachsen.
Als Familie.
Als Paar.
Als Menschen.